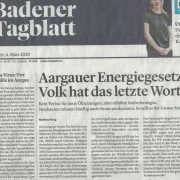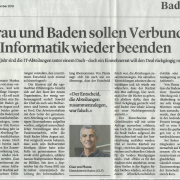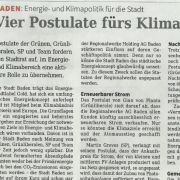«Das geht zu weit»: Überwachungs-Vollmacht für Aargauer Polizei – AZ
Die Aargauer Regierung ermächtigt die Polizei in der Coronakrise zu einer umfassenden Überwachung, weil sich manche Leute nicht an das Distanzverbot des Bundesrates halten. Das stösst bei Aargauer Kantonspolitikern auf Kritik – nicht aber beim ehemaligen Datenschutzbeauftragten Hanspeter Thür.
Die Aargauer Regierung geht mit ihrer Überwachungs-Vollmacht für die Polizei weiter als andere Kantone. Das löst politische Kritik aus. Gian von Planta, Grossrat der GLP und Einwohnerrat in Baden, hält die Massnahme für überzogen. «Dass anonymisierte Handydaten ausgewertet werden sollen, damit kann ich leben. Wenn nun aber neue Kameras aufgestellt und Leute beobachtet werden können per Liveüberwachung, geht das definitiv zu weit.» Das Grundgefühl der Freiheit dürfe nicht unnötig eingeschränkt werden. Die Zahlen zu den Neuansteckungen liessen derzeit insbesondere im Aargau nicht darauf schliessen, dass die Situation ausser Kontrolle gerate.
Von Planta attestiert Überwachungskameras eine präventive Wirkung: «Wo sie aufgehängt sind, treffen sich wohl tatsächlich weniger Leute.» Das Grundproblem werde aber nicht bekämpft: Leute, die sich in Gruppen treffen wollten, liessen sich davon nicht abhalten und verabredeten sich anderswo. Das zeige sich in Baden: «In der Stadt gibt es zwar enorm viele Überwachungskameras. Ich zweifle aber daran, dass sie tatsächlich zu einer tieferen Quote an Vergehen führen.»
«Überwachungsstaat aus dem Krankenbett hochgefahren»
Kritik kommt auch vom FDP-Grossrat Stefan Huwyler: «Regierungsrat Hofmann und Polizeikommandant Leupold fahren aus dem Krankenbett den Überwachungsstaat im Kanton Aargau hoch. Bei allem Respekt, das geht nun doch zu weit», schreibt er auf Twitter. Auf Nachfrage der AZ sagt Huwyler: «Ich schätze Regierungsrat Urs Hofmann und Polizeikommandant Michael Leupold sehr, aber diese Verordnung schiesst über das Ziel hinaus und ist mit unserer freiheitlichen Grundordnung nicht vereinbar.» Man bekomme den Eindruck, hier werde die Situation ausgenützt, um eine sehr weitgehende Überwachung der Bevölkerung einzuführen, kritisiert der Freisinnige.
Zur Videoüberwachung an sich sagt Huwyler: «Wenn eine zusätzliche Überwachung an gewissen Orten nötig ist, wäre es sicher möglich, dass die Datenschutzbeauftragte darüber rasch entscheidet, dafür gibt es diese Stelle ja.» Ohnehin hält der FDP-Grossrat die Fernüberwachung aus mehreren Gründen für wenig sinnvoll: «Wenn keine Polizei vor Ort ist, kann auch niemand intervenieren. Die Identifikation von Leuten, die gegen die Regeln verstossen, ist nur mit Kameras schwierig. Es ist fragwürdig, neue Kameras aufzustellen, nur um einige Ordnungsbussen auszustellen.» Sinnvoller wäre es aus Huwylers Sicht, wenn die Polizei bekannte Hot Spots regelmässig kontrollieren, die Leute auf die Abstandsregeln hinweisen und – wo angezeigt – Bussen aussprechen würde.
FDP-Präsident und SP: Regierung soll Verordnung zurücknehmen
FDP-Aargau-Präsident Lukas Pfisterer kritisiert die neue Verordnung auf Twitter ebenfalls scharf. Mit der flächendeckenden Liveüberwachung per Videokamera im ganzen Kanton wegen Covid-19 werde der Datenschutz ausgeschaltet, findet Rechtsanwalt Pfisterer. Das möge gegen Gewalt und Kriminalität noch angehen, «aber gegen Corona?» Pfisterers klare Forderung an den Regierungsrat zur Überwachungs- Verordnung: «Zurücknehmen!»
Dasselbe verlangt die SP Aargau per Mitteilung: Die Ermächtigung der Polizei solle umgehend zurückgenommen werden. Die flächendeckende digitale Überwachung verhindere keine Ansteckung mit dem Coronavirus. Hotspots müssten durch Polizeipräsenz gelöst werden, zudem halte sich die Bevölkerung «in beeindruckendem Mass an die Regeln».
Fraktionspräsidentin Claudia Rohrer findet, der Regierungsrat sollte die Information verstärken, das Verständnis erhöhen und den Aargauerinnen und Aargauern vertrauen, statt auf Überwachung zu setzen. SP-Präsidentin Gabriela Suter lässt das Argument nicht gelten, die Personalknappheit bei der Polizei lasse nicht genug Corona- Kontrollen zu. «Das Problem der mangelnden Ressourcen darf nicht durch erhebliche Eingriffe in Grundrechte der Menschen korrigiert werden.»
Warum wurde die Sicherheitskommission nicht gefragt?
Kritik kommt auch von FDP-Grossrat Titus Meier. Er fordert, dass die Kommission für öffentliche Sicherheit, der er selbst angehört, die Überwachungs-Vollmacht behandelt. «Der Entscheid braucht eine breitere Unterstützung», schreibt er auf Twitter. Dasselbe hält Kommissionspräsident Herbert H. Scholl in einem Mail an den Regierungsrat fest: „Die notverordneten Eingriffe in die persönliche Freiheit sind erheblich.“ Auch bei der Anwendung von Notrecht seien das öffentliche Interesse und eine eingeschränkte Verhältnismässigkeit zu beachten. „Da hier ein Ermessensspielraum besteht, ist eine minimale politische Abstützung erforderlich“, betont Scholl.
Die Möglichkeit, ohne Bewilligung der Datenschutz-Beauftragten zusätzliche Kameras zu installieren und zu betreiben, ist aus Sicht von Scholl unverhältnismässig. Er stellt mehrere Fragen: „Weshalb wird auf die Bewilligung der Datenschutzbeauftragten verzichtet? Wie viele Anlagen werden installiert? Was geschieht mit diesen Aufnahmen? Was unternimmt anschliessend die Polizei? Wie geht sie auf die aufgenommenen Personen zu? Welche Massnahmen ordnet sie gegenüber diesen Personen an?
Andreas Glarner: «Die meisten Kameras sind schon bewilligt»
Daniel Hölzle, Präsident der Aargauer Grünen, kritisiert gegenüber Tele M1: «Der Regierungsrat schiesst mit dieser Massnahme am Ziel vorbei.» Bei Sonnenschein sei das Übertragungsrisiko für Corona geringer, deshalb wäre es besser, wenn sich die Leute draussen statt drinnen treffen würden.
CVP-Nationalrätin und -Kantonalpräsidentin Marianne Binder sagt, dass ein derart massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Bevölkerung notwendig geworden sei, gebe ihr zu denken. «Wichtig ist, dass die Aufnahmen wieder gelöscht und keinesfalls für andere Zwecke verwendet werden.»
Ganz anders sieht dies SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner, der bei Tele M1 sagt: «Die vorgestellten Massnahmen des Regierungsrats zur Überwachung des öffentlichen Raums sind verhältnismässig.» Die zusätzlichen Vollmachten der Polizei für die Überwachung seien der ausserordentlichen Lage angemessen. Glarner argumentiert, die meisten Videokameras im Aargau seien ohnehin bereits durch die Datenschutzbeauftragte bewilligt worden. Zudem müssten die Kameras, die zur Überwachung der Corona-Regeln eingesetzt würden, auch gekennzeichnet werden. «Deshalb bin ich für diese Massnahme», sagt Glarner.
Ehemaliger Datenschützer Thür findet Überwachung vertretbar
Weniger kritisch als die meisten Kantonspolitiker äussert sich Hanspeter Thür – der heutige Grünen-Stadtrat in Aarau ist ehemaliger eidgenössischer Datenschutzbeauftragter. «Aus meiner Sicht ist die Erweiterung der Überwachungsrechte für die Kantonspolizei mit dieser neuen Verordnung vertretbar», sagt Thür. Der Regierungsrat mache Gebrauch von seinem Notverordnungsrecht, das sei verfassungsmässig abgedeckt und damit rechtens.
«Das Ziel einer stärkeren Überwachung des öffentlichen Raums, um die bundesrätlich angeordneten Abstandsregeln während der Coronapandemie durchzusetzen, wäre sonst wohl nur mit einer kräftigen Aufstockung des Polizeikorps möglich», gibt Thür zu bedenken. Das sei kurzfristig kaum machbar, deshalb halte er die Lösung mit den zusätzlichen Kameras für akzeptabel und verhältnismässig.
«Wichtig ist, dass die Verordnung zeitlich auf sechs Monate begrenzt ist die neu installierten Kameras danach wieder entfernt werden müssen», sagt Thür. Er begrüsst auch, dass laut der Verordnung klar signalisiert werden müsse, welche Kameras die Polizei zur Überwachung des öffentlichen Raumes einsetzt.
Warum ermächtigt die Aargauer Regierung die Polizei zur Echtzeit-Überwachung? Samuel Helbling, Mediensprecher von Urs Hofmann im Departement Volkswirtschaft und Inneres, sagt: «Der Regierungsrat hat auch gesehen, dass die Distanzregeln häufig nicht eingehalten werden.» Mit der Überwachung in Echtzeit habe die Polizei ein effektives Mittel, um zu überprüfen, ob sich die Leute an bestimmten Orten an die Abstandsregeln des Bundesrats halten. Er spricht von einer niederschwelligen Massnahme: «Wir wollen nicht von vornherein Parks und Anlagen schliessen.» Angesprochen auf den Eingriff in die Privatsphäre der Aargauerinnen und Aargauer sagt Helbling: «Die Kameras werden nur in Ausnahmefällen und nur an Hotspots eingesetzt, wo sich die Leute oft nicht an die Distanzregeln halten.» Das seien etwa Skater und Sportanlagen sowie Parks. Man werde weitgehend jene Kameras einsetzen, die bereits installiert sind.



 zes Abenteuer. Seit Mittwoch wissen die Badenerinnen und Badener, dass das politische Gastspiel ihrer parteilosen Stadträtin
zes Abenteuer. Seit Mittwoch wissen die Badenerinnen und Badener, dass das politische Gastspiel ihrer parteilosen Stadträtin