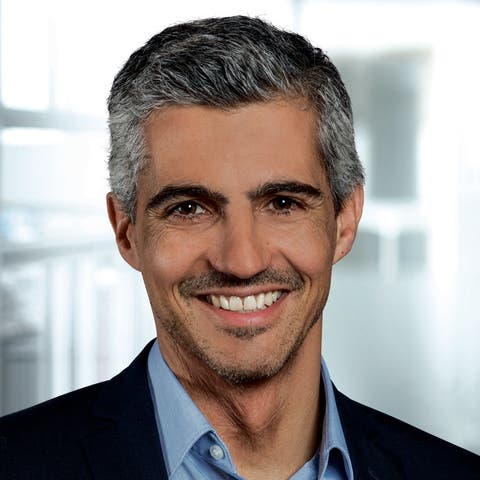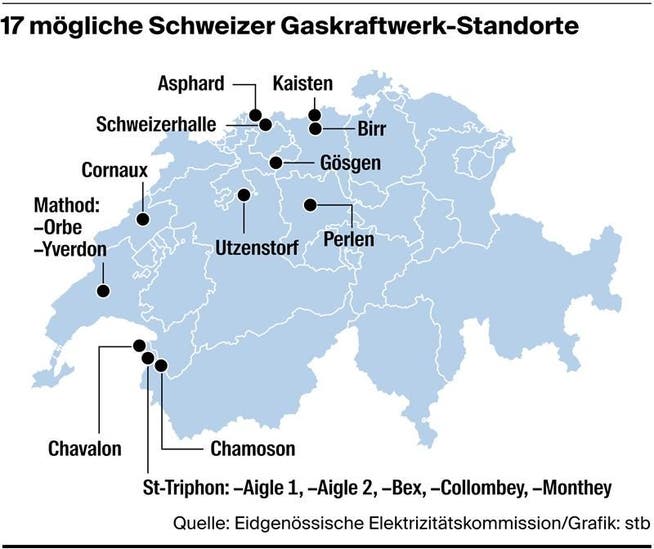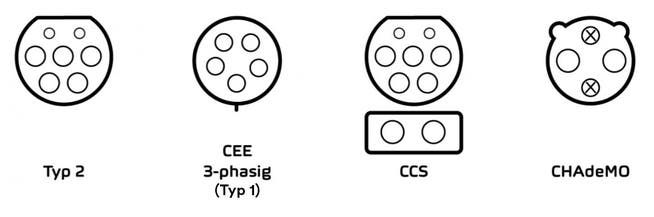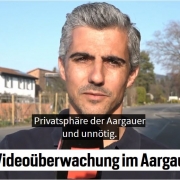Umstrittene Axpo Handelsgeschäfte – AZ
Umstrittene Axpo-Handelsgeschäfte im Ausland: Besitzerkantone zweifeln an Kompetenz des Verwaltungsrats – das fordert die Aargauer Regierung
Mit dem 4-Milliarden-Rettungsschirm steht die Axpo speziell im Fokus der Politik. Nun wird bekannt, dass der Aargau und andere Kantone an der Kompetenz des Verwaltungsrats zweifeln. Zudem fordern mehrere Parteien, dass sich die Axpo auf die Versorgung im Inland konzentriert und risikoreiche Handelsgeschäfte im Ausland aufgibt.
Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK): So hiess der Energieversorger, der mit Abstand am meisten Strom für den Aargau produziert, bis zur Jahrtausendwende. Der Kanton war Miteigentümer des Unternehmens, aus dem 2001 die Axpo hervorging. Auch an der Axpo ist der Aargau beteiligt: direkt und über eine Beteiligung der kantonseigenen AEW Energie AG mit insgesamt 28 Prozent. Ein zweiter Grossaktionär ist der Kanton Zürich, hinzu kommen weitere Kantone und Elektrizitätswerke.
Die Axpo machte vor zehn Tagen Schlagzeilen, als der Bund einen 4-Milliarden-Rettungsschirm beschloss, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Dies wurde nötig, weil die Axpo ihre Stromgeschäfte vorgängig mit hohen Summen absichern muss, der Ertrag aus dem Verkauf aber erst später in die Kasse fliesst. Der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger (FDP), der die Eigentümer vertritt, verteidigte die Intervention des Bundes und sagte, die Preise am Energiemarkt hätten sich überschlagen.
Kantone dürften Axpo nicht mit Steuergeldern retten
Auf die Frage, warum der Bund ein Unternehmen retten müsse, das im Besitz der Kantone sei, sagte Attiger:
«Es gibt in den Kantonen keine gesetzliche Grundlage, die es erlauben würde, Steuergelder als Kredit einem Stromkonzern zur Verfügung zu stellen.»

Stephan Attiger.
Ein kantonaler Schutzschirm wäre also nur mit neuen Gesetzen möglich gewesen. Zudem scheint fraglich, ob die Kantone eine solche Unterstützung finanziell überhaupt stemmen könnten.
Weniger positiv als Regierungsrat Attiger sieht der freisinnige Aargauer Nationalrat Matthias Jauslin den Rettungsschirm. «Die Kantone haben jahrelang Dividenden kassiert, aber nehmen dann ihre Verantwortung nicht wahr», kritisierte FDP-Energiepolitiker Jauslin in der «NZZ am Sonntag».
Besitzerkantone der Axpo zweifeln an Kompetenz des Verwaltungsrats
Doch auch die Besitzerkantone, welche den Rettungsschirm des Bundes begrüssen, sehen die Entwicklung der Axpo kritisch. Wie der «Tages-Anzeiger» am Donnerstag berichtete, hegen sie Zweifel an der Kompetenz der Unternehmensführung und haben deshalb eine Aussprache verlangt. Eine der Kernfragen, die in einem vertraulichen Dokument gestellt wird: «Ist der Verwaltungsrat fachlich in der Lage, die Expansionsstrategie (…) zu beurteilen und zu überwachen?»
Laut dem «Tages-Anzeiger» gibt es Befürchtungen, dass wegen der aggressiven ausländischen Handelsstrategie der Axpo in der Schweiz auf einmal zu wenig Strom zur Verfügung stehen könnte. Weiter fragen die Eigentümerkantone, ob es aus Sicht des Verwaltungsrats richtig sei, dass die Axpo in den nächsten Jahren rund 50-mal in neue erneuerbare Produktionsanlagen im Ausland investiere als im Inland.
Handel und Finanzinstrumente machen fast 50 Milliarden in der Bilanz aus
Kritisch beurteilt den Rettungsschirm auch Gian von Planta, Fraktionschef der GLP im Grossen Rat und Leiter Anlagen und Netze beim Lenzburger Energieversorger SWL AG. Die Intervention des Bundes wäre nicht nötig, wenn die Axpo nur ihr Kerngeschäft betreiben würde, schreibt der grünliberale Energiepolitiker auf Facebook.

Kraftwerke, Übertragungsanlagen und der Wert der Eigenstromproduktion für die nächsten drei Jahre zusammen machen in der Bilanz knapp 10 Milliarden Franken aus, die restlichen 55 Milliarden entfallen laut von Planta primär auf Handelspositionen und derivative Finanzinstrumente.
Regierung: Axpo ist als Grossproduzent auf den Handel angewiesen
Die umstrittenen Handelsgeschäfte der Axpo im Ausland kritisierte von Planta zusammen mit Grossräten von Grünen, EVP, Mitte und SP auch in einem Vorstoss. In der Antwort heisst es, der Regierungsrat thematisiere die Risiken bei den regelmässigen Eigentümergesprächen und lasse sich über das Risikomanagement der Axpo informieren. Und weiter:
«Der Regierungsrat erwartet, dass die Axpo die erheblichen Preis- und Kreditrisiken, insbesondere bei den heutigen Marktverwerfungen, eng überwacht.»
Die Antwort entspricht damit – in abgeschwächter Form – ziemlich genau der Kritik der Eigentümerkantone an die Axpo-Führung. Allerdings steht der Regierungsrat den Handelsgeschäften im Ausland nicht grundsätzlich negativ gegenüber. Er schreibt vielmehr: «Dass die Axpo in der aktuellen Situation von dieser Diversifizierung – namentlich auch im Ausland – profitiert und dank der Absicherung das Risiko der eigenen Produktion verringert, ist positiv zu werten.»
Das Handelsgeschäft sei ein Pfeiler des Geschäftsmodells der Axpo und könne nicht unabhängig von anderen Bereichen beurteilt werden. Der Regierungsrat schreibt: «Aufgrund ihrer Struktur als Grossproduzent und der Teilmarktliberalisierung ist die Axpo auf den Handel angewiesen.» Auslandsgeschäfte tätige der Energieversorger insbesondere dann, wenn sie den Zielen der Eignerstrategie dienen, betriebswirtschaftlich zweckmässig sind und die Risikosituation der Axpo nicht verschlechtern.
Grüne forderten schon vor zwei Jahren mehr Produktion im Inland
Die Forderung, die Axpo solle sich stärker auf die Stromproduktion im Inland konzentrieren, ist im Aargau nicht neu – und sie kommt aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Im August 2020 nahm der Regierungsrat ein Postulat der Grünen entgegen, das verlangte, «dass zukünftige Investitionen der Axpo prioritär in die heimische Stromproduktion der Wasserkraft beziehungsweise Wind, Sonne und Biomasse zur Stärkung der Versorgungssicherheit und Wertschöpfung zu erfolgen haben».
Die Regierung versprach, sich «im Rahmen der Überprüfung der Eignerstrategie» für das Anliegen der Grünen einzusetzen. In diesem Papier werden die strategischen Ziele der Eigentümerkantone für die Axpo festgehalten. Im aktuellen Vorschlag, der auf der Website des Kantons abrufbar ist, heisst es unter anderem, die Axpo leiste «einen wesentlichen Beitrag zur sicheren, wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Stromversorgung der Schweiz».
Axpo muss den Besitzerkantonen keinen Strom liefern
Gleich danach findet sich unter Punkt 1 der Axpo-Eignerstrategie ein bemerkenswerter Satz:
«Die Axpo hat keinen Auftrag zur Versorgung der Axpo-Kantone mit Elektrizität.»
Dies gilt allerdings erst seit der Strommarktliberalisierung im Jahr 2008, zuvor gab es eine Abnahmegarantie für Axpo-Strom. Das Unternehmen sei seit der Marktöffnung einem grösseren Risiko ausgesetzt, hält der Regierungsrat fest. Die Axpo diversifiziere in neue Geschäftsfelder, um die Abhängigkeit vom Strompreis zu reduzieren. «Dies hat sie in den letzten Jahren verstärkt im Ausland getan, weil die Wirtschaftlichkeit für Investitionen in der Schweiz nicht gegeben war», schrieb die Regierung im August 2020.
Zusammenfassend kam die Regierung zum Schluss, die Stossrichtung des Grünen-Postulats decke sich «weitestgehend mit der heutigen Eignerstrategie der Aktionäre». Sie hielt aber auch fest, welche Forderungen in der Eignerstrategie aufgenommen werden, hänge von der Mehrheit der Eigentümer ab. Anpassungen an der Strategie könne der Aargau «nur in Zusammenarbeit mit den übrigen Aktionären erreichen».
Freisinnige fordern Fokus auf Versorgungssicherheit im Inland
Knapp zwei Jahre später kam die Forderung im Grossen Rat erneut auf, im März 2022 reichte die FDP eine Motion ein. Demnach sollte die Regierung sicherstellen, «dass die Axpo Holding AG und die AEW Energie AG verstärkt in der Schweiz in die Versorgungssicherheit investieren, um der drohenden Versorgungslücke im Winter entgegenzuwirken». Der Regierungsrat ist bereit, das Anliegen als weniger verbindliches Postulat entgegenzunehmen. Er verwies aber erneut darauf, dass die Forderung nur mit Zustimmung der anderen Aktionäre realisierbar sei.
Weiter schrieb der Regierungsrat, AEW und Axpo investierten in den wirtschaftlich tragbaren Zubau erneuerbarer Energie im Inland und grenznahen Ausland. «Doch die Rahmenbedingungen (finanzielle Anreize, Bewilligungsverfahren, Raumplanung, Standorte etc.) sind im internationalen Vergleich sehr anspruchsvoll und das Tempo des Ausbaus zu langsam vor dem Hintergrund einer drohenden Stromlücke und dem Netto-Null-Ziel.»
GLP-Energiepolitiker Gian von Planta: «Die Axpo muss das Handelsgeschäft verkaufen, die Risiken sind zu hoch»
4-Milliarden-Rettungsschirm, Liquiditätsprobleme und risikoreiche Auslandsgeschäfte rufen die Politik auf den Plan. Der Grünliberale Grossrat Gian von Planta will, dass die Axpo ihr Handelsgeschäft abstösst. Zudem fordert er, dass wieder ein Regierungsmitglied im Verwaltungsrat des Energieversorgers sitzen soll.
Exklusiv für Abonnenten

Gian von Planta (GLP) fordert, dass sich die Axpo auf ihr Kerngeschäft, die Stromversorgung im Inland, konzentrieren solle.
Wie viel Einfluss sollen die Besitzerkantone und die Politik auf die Strategie der Axpo nehmen? Diese Frage ist nicht erst seit dem 4-Milliarden-Rettungsschirm des Bundes für den Energieversorger aktuell. Einst sassen Vertreter der Kantonsregierungen im Verwaltungsrat der Axpo und bestimmten dort direkt mit.
Seit fünf Jahren ist der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger nicht mehr im Führungsgremium, stattdessen gibt der Regierungsrat die Ziele für das Unternehmen über die sogenannte Eigentümerstrategie vor. Die Absicht dahinter: Den Verwaltungsrat entpolitisieren und mit unabhängigen Fachleuten besetzen.
Besitzerkantone und Grossräte melden Zweifel an Axpo-Strategie an
Vor dem Hintergrund der Energiekrise, der Liquiditätsprobleme der Axpo und der risikoreichen Auslandsgeschäfte werden nun aber Forderungen nach mehr Einfluss der Besitzerkantone laut. Diese bezweifeln, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens in der Lage ist, die Expansionsstrategie der Axpo zu beurteilen und zu überwachen.
Der Aargauer Regierungsrat schreibt in der Antwort auf einen Vorstoss im Grossen Rat, gemäss Angaben der Axpo überwache das auditierte Risikomanagement die Handelsaktivitäten regelmässig. GLP-Energiepolitiker Gian von Planta, der in seiner Interpellation diverse kritische Fragen zur Axpo-Strategie stellte, reicht dies nicht, wie er im Interview sagt.
Der «Tages-Anzeiger» berichtet heute über Kritik der Eigentümerkantone am Axpo-Verwaltungsrat. Dabei wird die Frage gestellt, ob die Verwaltungsräte fachlich in der Lage seien, die Expansionsstrategie zu überwachen. Sind sie das aus Ihrer Sicht?
Gian von Planta: Das ist eine berechtigte Frage, denn momentan hat der Handel in der Bilanz der Axpo ein massives Übergewicht gegenüber dem eigentlichen Kernauftrag, nämlich der Stromproduktion und Energieversorgung. Solche Handelsgeschäfte können sehr viel Ertrag bringen, sie sind aber hochriskant und die Axpo kann auch viel Geld verlieren.
Aber ist das nicht der politische Wille, schliesslich wurde die Axpo ja in die Selbstständigkeit entlassen?
Bei der Axpo gibt es derzeit keine klare Führung durch die Eigentümer, das Management nutzt den Freiraum, den ihr die Politik lässt, um Handelsaktivitäten und andere Geschäftsfelder auszubauen, die eigentlich nicht zum Auftrag des Unternehmens gehören. Das ist kein direkter Vorwurf an die Axpo-Führung, sondern ein Aufruf an die Besitzerkantone, wieder mehr Einfluss zu nehmen.
Braucht es wieder Regierungsräte im Verwaltungsrat der Axpo?
Ich finde, dass die verantwortliche Regierung grundsätzlich Einsitz haben sollte im Verwaltungsrat, damit die Eigentümerkantone ein Ohr in diesem Gremium haben und Informationen direkt und ungefiltert erhalten. Der Verwaltungsrat der Axpo darf aber nicht nur aus Politikern bestehen, es braucht selbstverständlich auch Fachleute aus der Energiebranche und dem Management. Eine solche Mischung würde auch dafür sorgen, dass der Verwaltungsrat nicht verpolitisiert wird.
Muss die Konzentration auf Stromproduktion im Inland und die Beschränkung des Handels in der Eigentümerstrategie festgeschrieben werden?
Eigentlich wäre das richtig, es gibt aber ein grosses Problem: Änderungen an der Eigentümerstrategie können nur einstimmig von allen Aktionären vorgenommen werden. Das ist bei den heutigen Besitzverhältnissen mit mehreren Kantonen und Elektrizitätswerken praktisch unmöglich. Deshalb ist es für die Eigentümerkantone auch schwierig, ihren Einfluss auf die Axpo geltend zu machen. Es wäre von mir aus sinnvoll, die Besitzverhältnisse zu klären, indem zum Beispiel der Kanton Aargau die Axpo-Anteile übernimmt, die derzeit noch von der AEW Energie AG gehalten werden.
Was wäre aus Ihrer Sicht denn die beste Lösung der Axpo-Frage?
Von mir aus gesehen müsste die Axpo das Handelsgeschäft verkaufen, die Risiken sind einfach zu hoch. Zudem ist dies keine Staatsaufgabe und es gibt dafür keine gesetzliche Grundlage. Das Unternehmen braucht eine kleine Handelsabteilung für den Verkauf des selbst produzierten Stroms, aber ich finde es falsch, wenn die Axpo mit risikoreichem Gas- und Stromhandel in Amerika und Asien die Bilanz um mehr als 50 Milliarden Franken aufbläht.