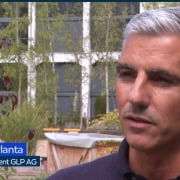Verdichtetes Bauen – AZ
«In Baden soll man dichter bauen können»: Gian von Planta fordert Regierungsrat zum Handeln auf
Die Vorgaben auf kantonaler Ebene zur Mindestdichte in Städten seien nicht mehr zeitgemäss, findet der GLP-Politiker. Die Folge: Mietpreise steigen ins Unermessliche, und Zersiedelung nehme zu. In Baden Nord und Oberstadt sollten viel mehr Hochhäuser gebaut werden können, so von Planta.
Die Frage, wie sich Baden städtebaulich in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickeln wird – konkret ob es wieder mehr Wohnraum gibt – hängt massgeblich von der Bau- und Nutzungsordnung ab, die derzeit überarbeitet wird. Sie regelt zum Beispiel, wo künftig wie hoch und unter welchen Voraussetzungen gebaut werden kann.

Gian von Planta wünscht sich mehr Hochhäuser in Badens Zentrum.
Der Entwurf zur BNO lag kürzlich zur Revision vor – und GLP-Grossrat Gian von Planta aus Baden ist nicht zufrieden. Er findet: «Man müsste in Baden sehr viel dichter bauen können, zumindest an gewissen Stellen.» Der Vorschlag für die neue BNO ist ihm viel zu wenig mutig.
Problematik wird in Baden besonders deutlich
Ein Grundproblem aus seiner Sicht sind die Vorgaben auf kantonaler Ebene. Ein zentrales Instrument seien die Mindestdichtevorgaben für Innenentwicklung im kantonalen Richtplan Aargau. In einem Vorstoss, den Von Planta im Grossen Rat eingereicht hat, will er jetzt die Vorgaben zur Mindestdichte verändern.
«Die Problematik wird in Baden besonders deutlich: Obwohl Baden heute bereits hohe Dichten aufweist, hervorragend an den öffentlichen Verkehr angebunden ist und als wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung im Richtplan ausgeschieden ist, verfügt die Stadt über keinen Wohnschwerpunkt im kantonalen Richtplan», argumentiert von Planta. Stattdessen gelte lediglich eine Mindestdichte von 70 bis 90 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Hektare.
Selbst wenn die gesamte Fläche theoretisch bebaubar wäre, liesse sich mit diesen Vorgaben keine hochwertige, nachhaltige Siedlungsentwicklung erzielen. Das Beispiel Baden zeige, dass die geltenden Mindestdichtevorgaben nicht ausreichen, um die bundesrechtlichen Ziele zur haushälterischen Bodennutzung und zur Förderung einer nachhaltigen Innenentwicklung zu erreichen.
An vielen Standorten im Kanton seien die Werte zur Mindestdichte bereits heute erreicht, was keinerlei Anreize für eine ambitionierte, qualitätsvolle Innenentwicklung schaffe.
Der Regierungsrat soll handeln
In seinem Vorstoss stellt von Planta dem Regierungsrat nun diverse Fragen. Unter anderem will er wissen: Weshalb verfügt eine Stadt wie Baden – mit hoher Dichte, sehr guter ÖV-Anbindung und kantonalem Entwicklungsschwerpunkt – über keinen Wohnschwerpunkt, und sieht der Regierungsrat hier Handlungsbedarf? Wie beurteilt der Regierungsrat die Wirkung der im Richtplan festgelegten Mindestdichtevorgaben von 70–90 Einwohnern pro Hektare für Kernstädte, insbesondere dann, wenn wie im Beispiel Baden kein Wohnschwerpunkt festgelegt wird? Und: Plant der Regierungsrat, die Vorgaben des Richtplans – insbesondere die Dichtevorgaben – zu überarbeiten, um eine nachhaltige, nach innen gerichtete Siedlungsentwicklung besser sicherzustellen?

Gian von Planta, GLP-Grossrat aus Baden.
Für von Planta ist klar: Wenn mehr Wohnraum gebaut werden kann, steigt die Leerwohnungsziffer langfristig an, und die Mietpreissteigerungen könnten gebremstwerden. Die Effekte wären aber erst langfristig spürbar. «Klar ist, dass mein Vorstoss für die laufende BNO-Revision wohl zu spät kommt. Aber es muss sich langfristig etwas ändern.»
Ein Stockwerk mehr bauen zu dürfen, reiche nicht aus, um Baden zu einer dicht bebauten Stadt zu machen. Ein Hochhaus zu erstellen, müsse an viel mehr Orten in der Stadt möglich sein. Er denkt beispielsweise an das Gebiet rund um den Bahnhof Oberstadt oder Baden Nord. Dort, findet von Planta, wären die Voraussetzungen für ein dichtes, urbanes Wohngebiet gegeben.
Die Folge der zu wenig dicht bebauten Stadt Baden sei, dass in
Aussengemeinden sehr viel gebaut werde. Dadurch wiederum nehme der Verkehr in die Stadt zu. «Verdichtung stoppt die Zersiedelung, reduziert den Verkehr und schont die Landschaft. »